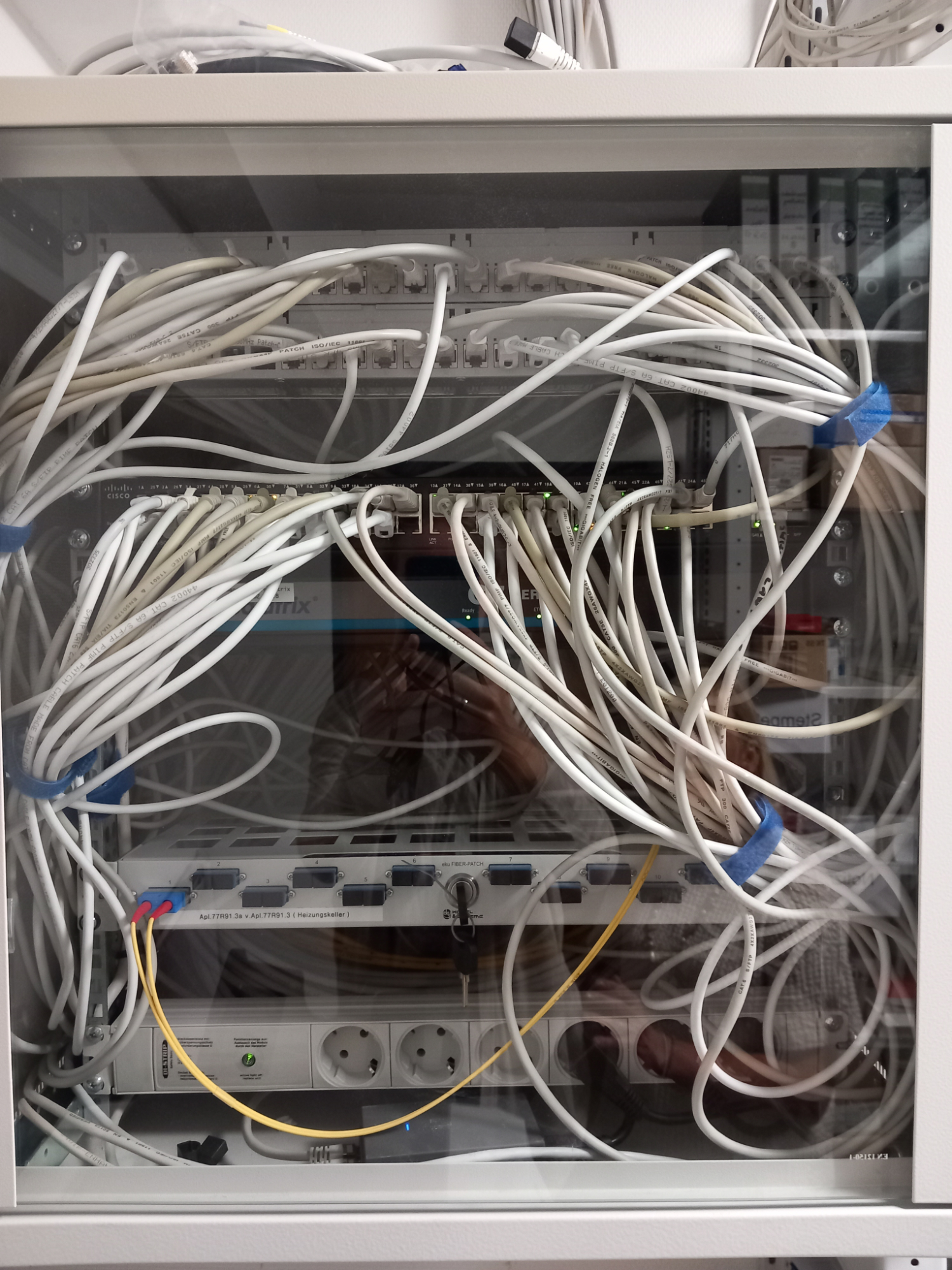
Forschen
Forschung in der Allgemeinmedizin
Ein Schwerpunkt der Arbeit am Institut für Allgemeinmedizin Essen liegt in der innovativen Versorgungsforschung mit einem Fokus auf Patient:innen und hausärztlichen Praxisteams. Um allgemeinmedizinische Forschung wirkungsvoll durchführen zu können, forschen wir gemeinsam mit unseren mehr als 200 Lehr- und Forschungspraxen.
Zentrale Ziele der Forschungsaktivitäten des Instituts sind:
- Identifikation relevanter Themen aus der Praxis und Integration in die Forschung
- Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die hausärztliche Versorgung
- Gestaltung nachhaltiger Patientenversorgung auf Basis evidenzbasierter Medizin (Wissenschaft, Expertise, Präferenzen)
Unsere Forschungsprojekte und Studien werden u.a. von verschiedenen Landes- und Bundesministerien gefördert.
Koordination Forschung

Univ.-Prof. Dr. rer. nat.
Michael Pentzek
Koordination Forschung

Susanne Löscher
